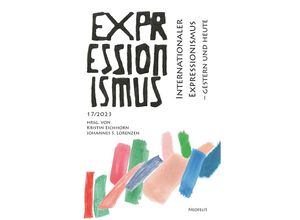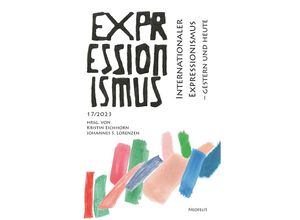Der Expressionismus scheint als Bewegung uneingeschränkt mit Deutschland verbunden zu sein
sowohl im Hinblick auf Topoi der Bildenden Kunst als auch hinsichtlich ästhetischer
Konventionen literarischer Werke. Auch in Bezug auf traditionelle und neue Medien werden zur
Definition des 'expressionistischen' Stils im Wesentlichen Werke deutscher Herkunft
herangezogen. Ebenso sind die zentralen Künstler*innengruppen mit deutschen Städten verbunden.
Dennoch ist der Expressionismus kaum außerhalb seines internationalen Netzes zu denken. Dies
gilt aufgrund der wechselseitigen Beeinflussung verschiedener internationaler
avantgardistischer Bewegungen die prinzipiell die Frage nach der nationalen Profilierung
aufwirft. Darüber hinaus wurde der (deutsche) Expressionismus am Übergang zwischen den 1920er
und 1930er Jahren selbst zu einer Art 'Exportschlager' - vor allem auch dadurch dass viele
seiner Vertreter*innen infolge der Ächtung ihrer Kunst im Nationalsozialismus das Land
verlassen mussten. Das Heft wirft die Frage auf inwiefern der Expressionismus eine zeitlich
gebundene und auf eine bestimmte geografische Region bezogene Strömung oder Epoche ist. Dafür
stellen die Beiträge einerseits exemplarische Orte des internationalen Expressionismus wie den
Oberrhein als Grenzregion zwischen Deutschland Frankreich und der Schweiz vor. Weiterhin
eruieren sie die Vielfalt der internationalen Verflechtungen etwa in der österreichischen
Primitivismusdebatte in der deutschen und niederländischen Kunst und Literatur im Russland-
und Europabild von Boris Pil'njak in der lateinamerikanischen Diskussion um das Manifest in
der Rezeption des deutschen Expressionismus und der US-amerikanischen abstrakten Kunst im
Kontext der documenta sowie im literarischen Werk des Netzwerkers und Aussteigers Bruno Goetz.
Mit Beiträgen von Julia Allerstorfer-Hertel Nanne Buurman Sylvia Claus Uwe Czier Carmen
Gómez García Christine Pappelau Susanne Pocai und Katharina Wolf.