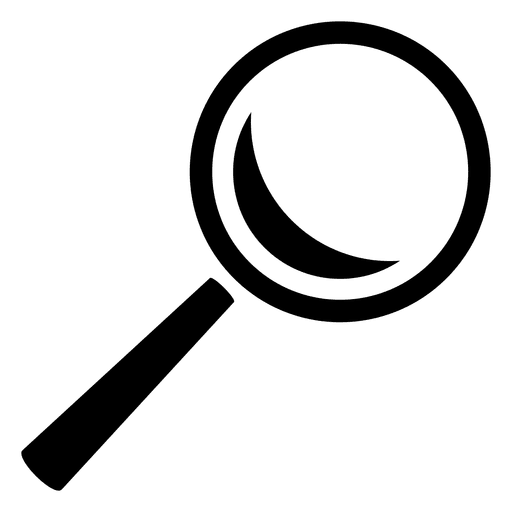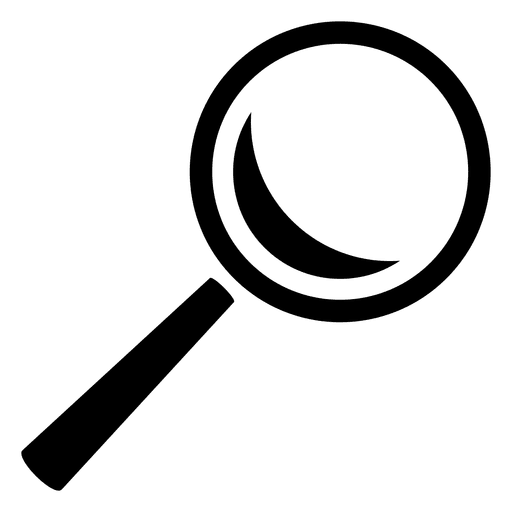Das Verbot von Verwandtenehen (Inzest) stand vom 6. bis ins 11. Jahrhundert im Mittelpunkt der
Gesetzgebung. Kaiser und Könige Bischöfe und Päpste erließen immer wieder neue Regelungen zum
Inzestdelikt und stellten diese Bestimmungen häufig an die Spitze von Gesetzestexten und
Kodifikationen. Die Reichweite der verbotenen Verwandten wurde dabei stetig ausgedehnt. Im 11.
Jahrhundert war es kaum möglich Ehen zu schließen die nicht aufgrund des Inzestverbots
angefochten werden konnten. Die Sorge um die Gültigkeit von Eheschließungen beschäftigte
insbesondere den Adel da mit der Illegitimität der Kinder der soziale Status auf das Spiel
gesetzt wurde.Über dieses einzigartige Phänomen wird in der historischen ethnologischen und
soziologischen Forschung eine intensive Diskussion geführt. Dieses Buch zeichnet die radikale
Ausdehnung der Ehehindernisse erstmals epochenübergreifend und transkulturell nach. Es wird die
These aufgestellt dass die Entstehungsbedingungen dieser Obsession im Funktionswandel von
Gesetzgebung und in den Reaktionen von Königen Kaisern und Bischöfen auf den Verlust antiker
Staatlichkeit zu suchen sind. Die ausgedehnten Inzestverbote sollten die Etablierung
überregionaler Heiratsmärkte herbeiführen und dadurch der Integration von Großreichen dienen.