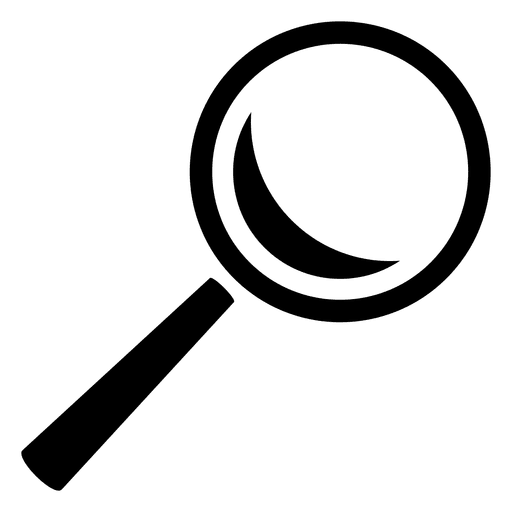Filmkunst lebt nicht zuletzt von der Farbe.. Doch wie kann man diese elementare Intensität des
Kinos methodisch in den Griff bekommen? Sich mit Farbe im Kinoerleben zu beschäftigen führt in
die Gefilde unterschiedlichster Disziplinen deren Grenzen sich in den Untersuchungen
überschneiden. Der Fokus auf die Wahrnehmung streift die Neurobiologie ebenso wie die
Psychologie oder die Physik filmwissenschaftliche Forschungsfragen über ästhetische
Farbgestaltung betreffen gleichermaßen die Kunstwissenschaft Philosophie und Kulturtheorie.
Methodisch betrachtet ist die medientheoretische und filmanalytische Auseinandersetzung mit
Farbe also alles andere als «monochrom» sondern hochkomplex und vielschichtig. Farbe kann
Kohärenz im diegetischen Raum der Erzählung stiften sie kann aber auch quer dazu stehen - in
allen Fällen übernimmt sie eine Kommunikationsfunktion die wiederum von kulturellen
Kodierungen und Konventionalisierungen abhängig ist. Farbdramaturgien im Sinne von Kontrasten
und Kompositionen betreffen alle Bereiche des kinematografischen Artefakts: Kostüme Licht- und
Schattensetzung Set- und Sound-Design bis hin zu Technikgeschichte und Postproduktion.
Gattungs- und Genrekonventionen des Films gehen oft mit speziellen Farbikonografien einher.
Insgesamt spielt die Beschäftigung mit Farbe eine zentrale Rolle für die filmische
Stilgeschichte. All diese Wechselwirkungen spiegeln in der komplexen Multimodalität des Kinos
die Herausforderungen der theoretischen und analytischen Auseinandersetzung mit der Farbe
deren materialästhetische Fragen eng mit der Technikgeschichte verknüpft sind.