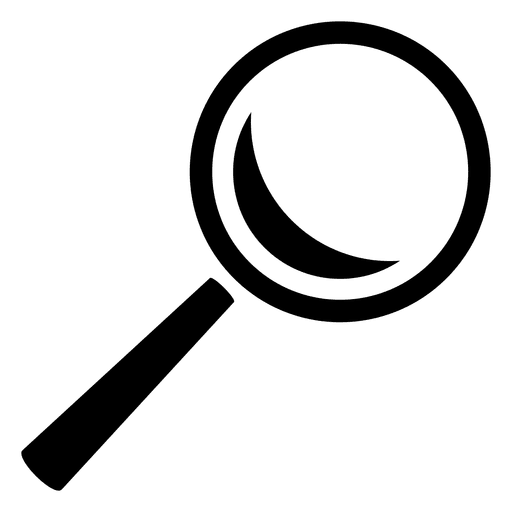In den Jahren 1927 bis 1932 in der Zeit von Weltwirtschaftskrise und aufkommendem
Nationalsozialismus zieht sich Wilhelm Lehmann in die karge Schwansener Landschaft im
Nordosten Schleswig-Holsteins zurück um zu wandern riechen schmecken sehen fühlen. Voller
Ehrfurcht und Poesie doch immer genau in ihren Beobachtungen sind seine Aufzeichnungen dieser
Erfahrung des Naturschönen deren Sprache eher an britischen denn an deutschen Autoren geschult
ist eher an Wordsworth denn an Hölderlin erinnert. Ihre Chronologie folgt dem Zyklus der
Jahreszeiten ihr Gegenstand ist das Wunder des Werdens Reifens und Vergehens das sich in der
Melodie des Zaunkönigs ebenso offenbart wie im Hundegebell. Eine Raupe kurz vor ihrer
Verpuppung erscheint dieser Beobachtung ebenso staunens- und berichtenswert wie ergraute
Disteln ein neugeborenes Lamm die Windstille eines Sommertags. So beschwört das Bukolische
Tagebuch ein naturverbundenes Leben das die Gaben die es nutzt nicht verschwendet sondern
schont. 1923 gemeinsam mit Musil von Döblin mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet gehört Lehmann
heute zu den unbekannten Klassikern der deutschen Literatur.