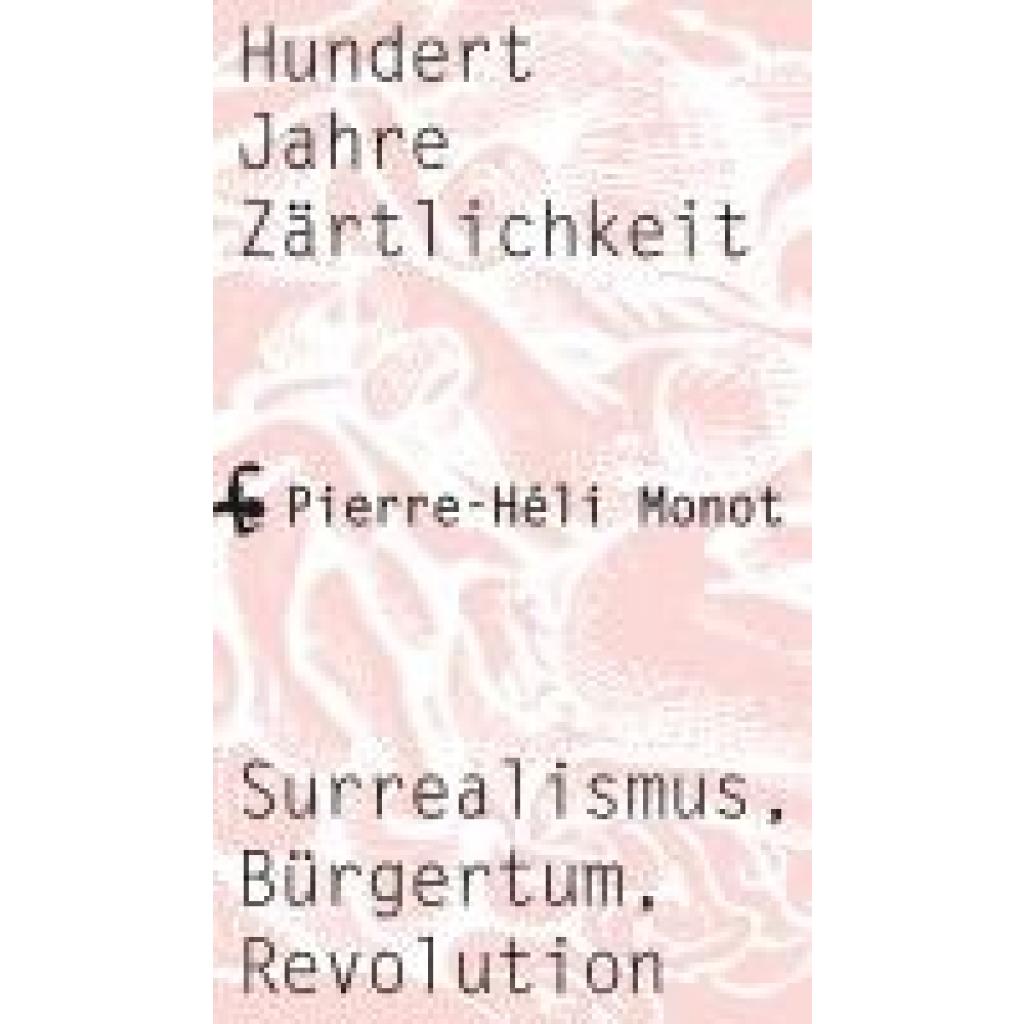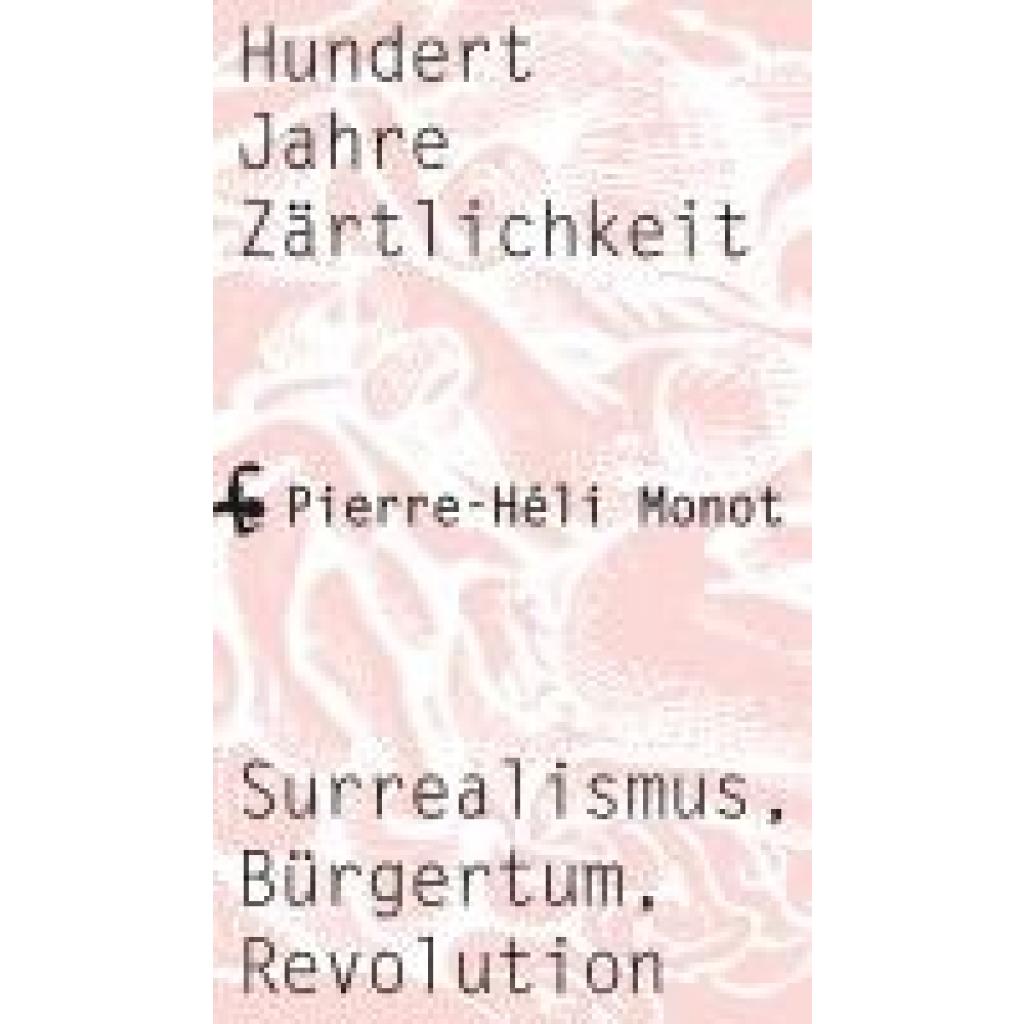Im politisch so umkämpften wie ereignisreichen 20. Jahrhundert kommt dem Surrealismus wie ihn
André Breton 1924 in seinem Ersten Surrealistischen Manifest entwarf eine Sonderstellung
zu: Obwohl er heute selten anders denn als künstlerische Avantgarde rezipiert und erzählt wird
handelte es sich tatsächlich um eine bürgerliche Aufbruchsbewegung die das Bürgertum selbst
vor seine Widersprüche zu stellen versuchte. In Romanen Aufsätzen und Gedichten konzipierten
die Surrealisten eine Politik der minimalen Ansprüche die das Bürgertum an sich selbst
zwingend stellen soll: falls das Bürgertum diesen minimalen Redlichkeits- und
Folgerichtigkeitsansprüchen nicht gerecht werden sollte so gehörte es abgeschafft. In beiden
Fällen würden sich nämlich die Werte von Freiheit Gleichheit und Solidarität realisieren
indem bürgerliche Privilegien aufgegeben und gemeinsame Werte erkämpft werden könnten. Hundert
Jahre nach seiner Ausrufung ist der Surrealismus brandaktuell für unsere krisengebeutelte
Gegenwart in der die bürgerliche Klasse nicht nur verkennt dass sie kaum noch gemeinsame
Klasseninteressen hat sondern auch angesichts steigender Ungleichheit ganz und gar historisch
gelähmt ist. Der radikale Freiheitsbegriff der sich aus dem surrealistischen Programm ergibt
erlaubt uns heute eine Politik der Möglichkeiten angesichts apokalyptischer Aussichten zu
denken - wenn wir den Surrealismus nicht nur feiernd historisieren sondern erneut als
konkreten Ausgangspunkt politischer Bewegungen begreifen. Doch dies ist schließlich ein Buch
über einen historischen Präzedenzfall: bürgerliche Revolten gegen das Bürgertum sind immer auch
Enthemmungsmomente deren Preis die Gesellschaft unter Umständen schließlich zahlen muss.