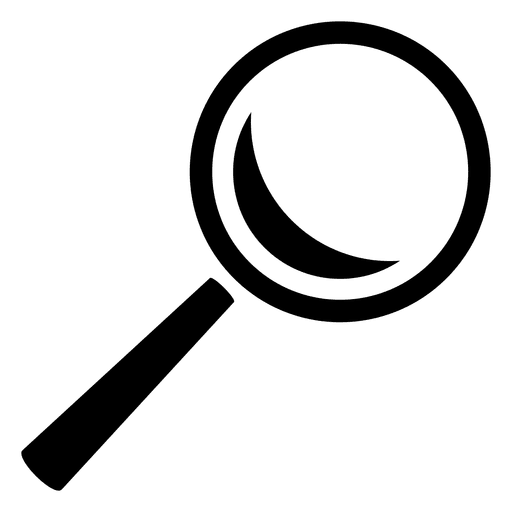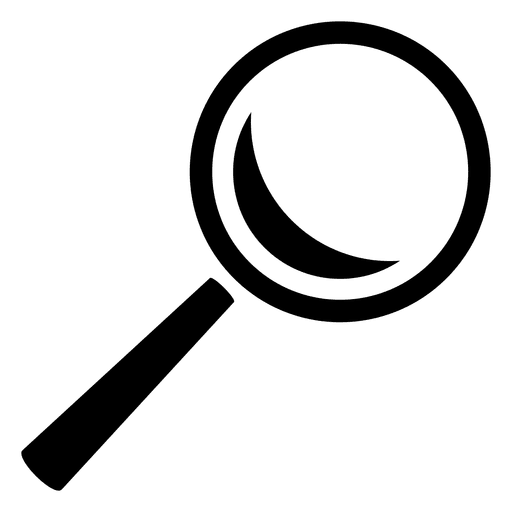Im Zentrum des Buches steht die Frage nach der Zukunft der Ethik. Es geht dabei nicht um die
Rolle und die Funktion der ethischen Theoriebildung im Kontext zu erwartender Entwicklungen
sondern in erster Linie um eine phänomenologisch orientierte Untersuchung des Vermögens der
Ethik sich auf die Offenheit des Künftigen so einzulassen dass die Zukunft nicht primär von
Vergangenem her erschlossen wird. Ausgangspunkt der Untersuchung ist Hans Jonas' Das Prinzip
Verantwortung das im Zuge einer zunehmend technisierten und ökonomisierten Gegenwart einen
Befund über den Zustand der Ethik im ausgehenden 20. Jahrhundert liefert. So nennt Jonas seinen
Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation bezeichnenderweise ¿Notstandsethik¿ und
begründet die Notwendigkeit einer solchen durch das Aufkommen eines Sinn stiftenden
Bewegungsgesetzes welches - der Art wie der Größenordnung nach - allem unähnlich ist was der
Mensch bislang erfahren hat und worauf die Ethik bisher ausgerichtet war. Die Notstandsethik
stellt so gesehen eine Zäsur in der Tradition des Denkens dar. Sie versucht dem
technisch-ökonomisch inspirierten Bewegungsgesetz und den daraus erwachsenden Gefahren in Form
systemischer Imperative korrektiv zu begegnen ohne dabei die eigene Zukunftsfähigkeit zu
thematisieren. Wo indes die überlieferte Ethik der gegenwärtigen Erfahrung nicht mehr
entspricht und die Ethik wie Jonas sagt Niemandsland betritt stellt sich die Frage nach
ihrer Zukunft von Neuem.