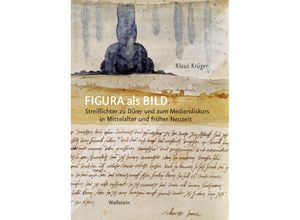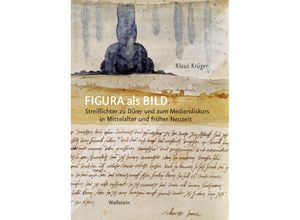Im Diskurs um »figura« kristallisieren sich in Mittelalter und früher Neuzeit vielzählig
facettenreiche Vorstellungen von der Medialität bildlicher Figurenevidenz die sich
exemplarisch im Werk von Dürer fassen lassen. Entstammt »figura« als Begriffskategorie der
Rhetorik und der biblisch-theologischen Exegese so ist sie doch zugleich auch den vielfältigen
Diskursen um die bildliche Formschaffung aus der Kraft einer figurierenden Imagination
verknüpft. Im Zentrum steht dabei die Frage welche visuelle und materielle Konkretheit der
figuralen Bildlichkeit und ihrer ästhetischen Gestalt zukommt. Mit »figura« werden gleichsam
die medialen Bedingungen und Effekte der bildlichen Evidenz mit all ihren Interferenzen von
Repräsentation und Präsenz dem 'Was' und dem 'Wie' des Bildes aufgerufen. Diese Evidenz reicht
über die Figürlichkeit im Sinn einer gegenständlich fassbaren und motivisch definierten
Repräsentation hinaus und hebt auf eine Sinnfülle und Erfahrungsdimension des Dargestellten ab
die sich wesentlich aus der Präsenz seiner bildlichen Erscheinung selbst ergibt und jenseits
des ästhetischen Soseins dieser bildnerisch-medialen Ausprägung nicht zu fassen ist. Das
facettenreiche Spektrum dieses Diskurses umfasst mittelalterliche Kontroversen um Christi
figurale Gegenwart im Bild oder Entwürfe der »imago figurata« im Barock ebenso wie
künstlerische Praktiken der Renaissance etwa bei Leonardo und in exemplarischer Weise bei
Albrecht Dürer.