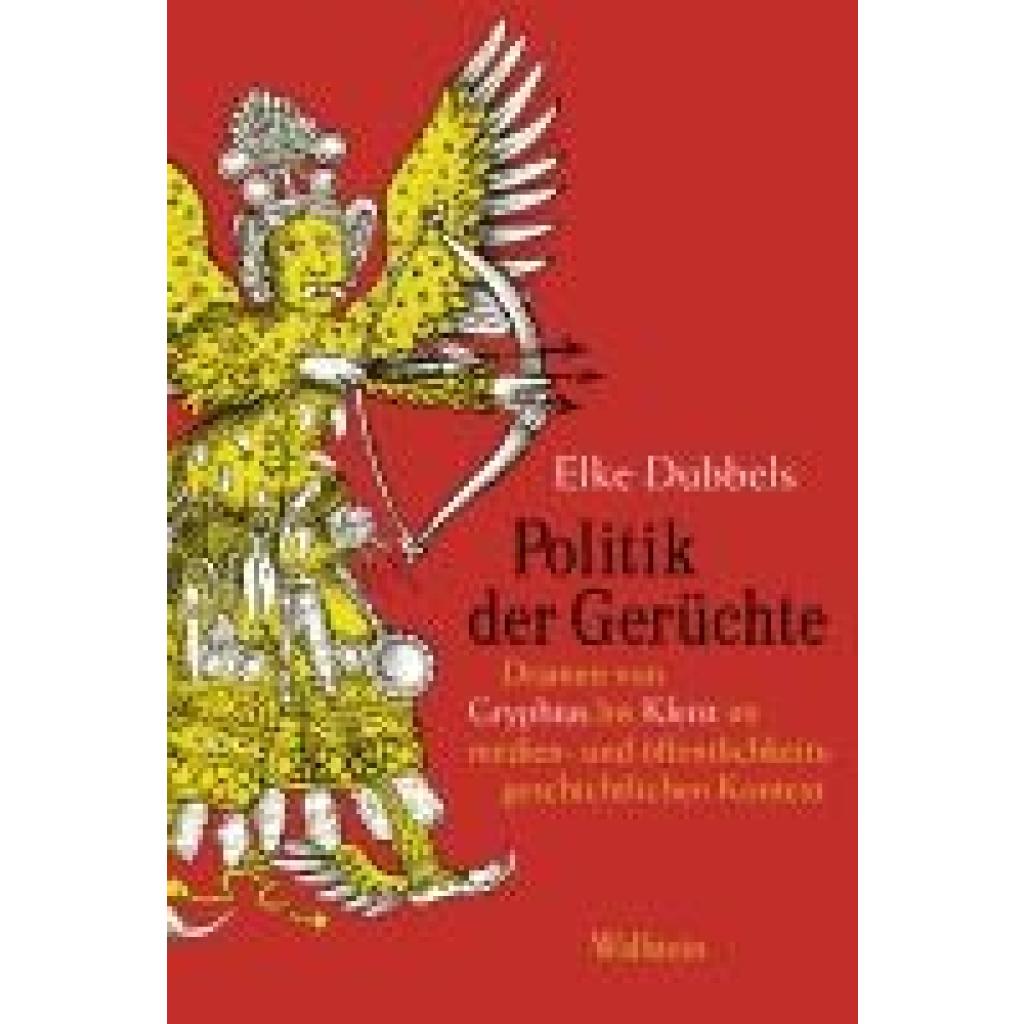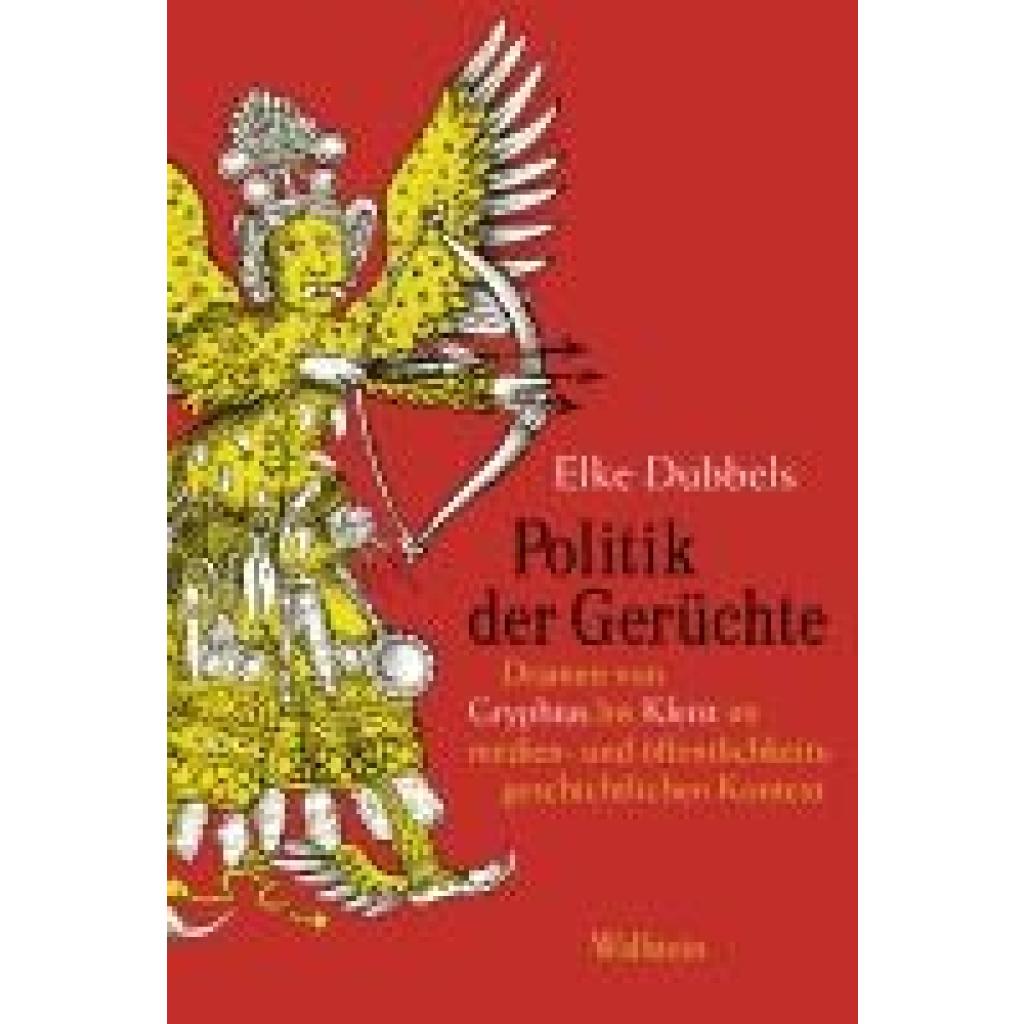Gerüchte sind ein politisch brisantes Kommunikationsphänomen. Dramen von der Frühen Neuzeit bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts inszenieren reflektieren und kommentieren es auf erhellende
Weise. Die politische Wirkungsmacht von Gerüchten ist ambivalent: Sie können Aufstände
provozieren aber auch von Regierungen absichtsvoll verwendet werden. Die politische Virulenz
von Gerüchten ist bereits in der Frühen Neuzeit erkannt und in barocken Trauerspielen
dramatisch verarbeitet worden. In einer breit angelegten Studie die kommunikationstheoretisch
orientierte Dramenanalysen mit medien- wissens- und öffentlichkeitsgeschichtlichen
Herangehensweisen verbindet untersucht Elke Dubbels wie Gerüchte in Dramen von der Mitte des
17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts als Kommunikationsgeschehen dargestellt werden. Im
Anschluss an einen systemtheoretisch inspirierten Begriff von Öffentlichkeit als »beobachteter
Beobachtung« (Schlögl) werden Dramen als Reflexionsmedium politischer Öffentlichkeit
erschlossen. Im Zentrum steht die Frage wie die Stücke Gerüchte in Szene setzen und sich zu
der von ihnen dargestellten Öffentlichkeit verhalten. Es zeigt sich dass die untersuchten
Dramen ihre Leser*innen nicht nur für die politische Bedeutung von Gerüchten sensibilisieren
und sich von diesen abgrenzen indem sie ihnen andere Modelle der Kommunikation
gegenüberstellen. Vielmehr beteiligen sie sich zum Teil auch performativ an den
gerüchtegetriebenen Meinungskämpfen die sie darstellen.