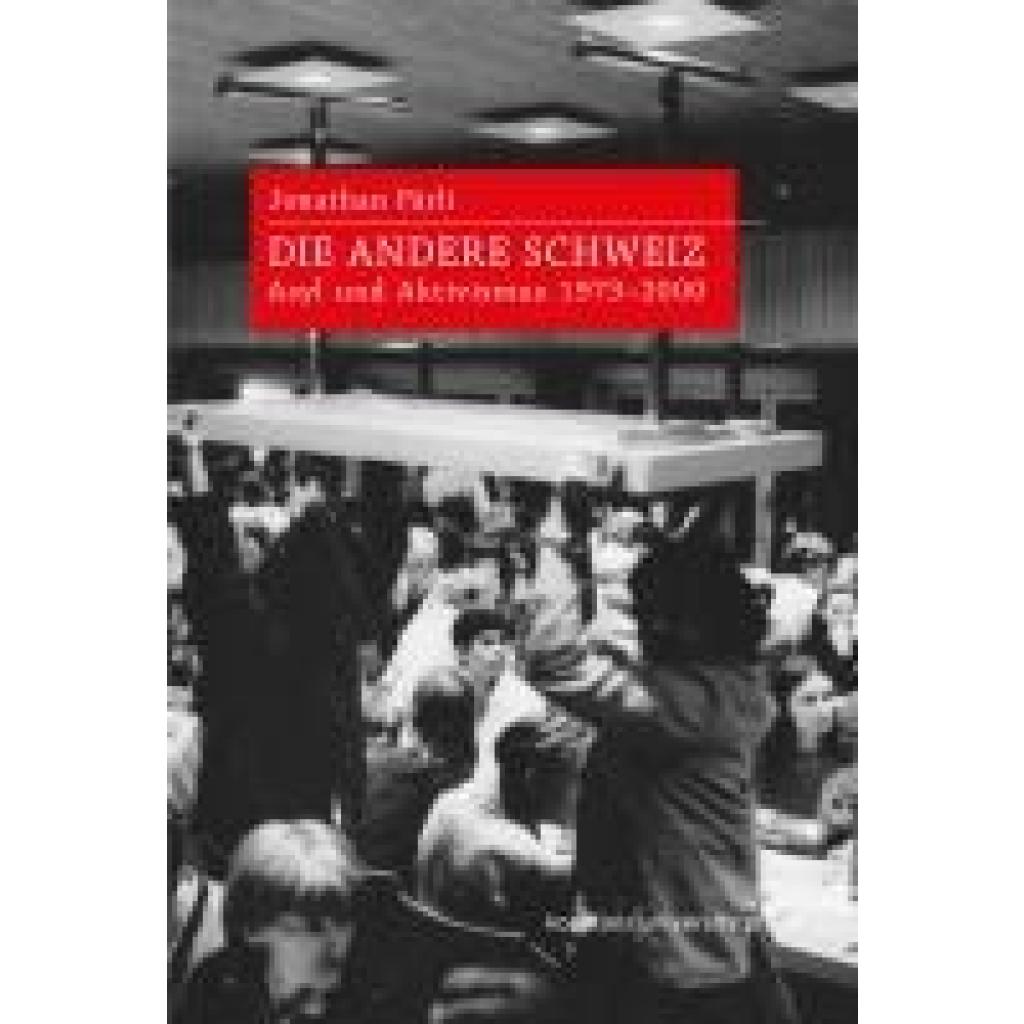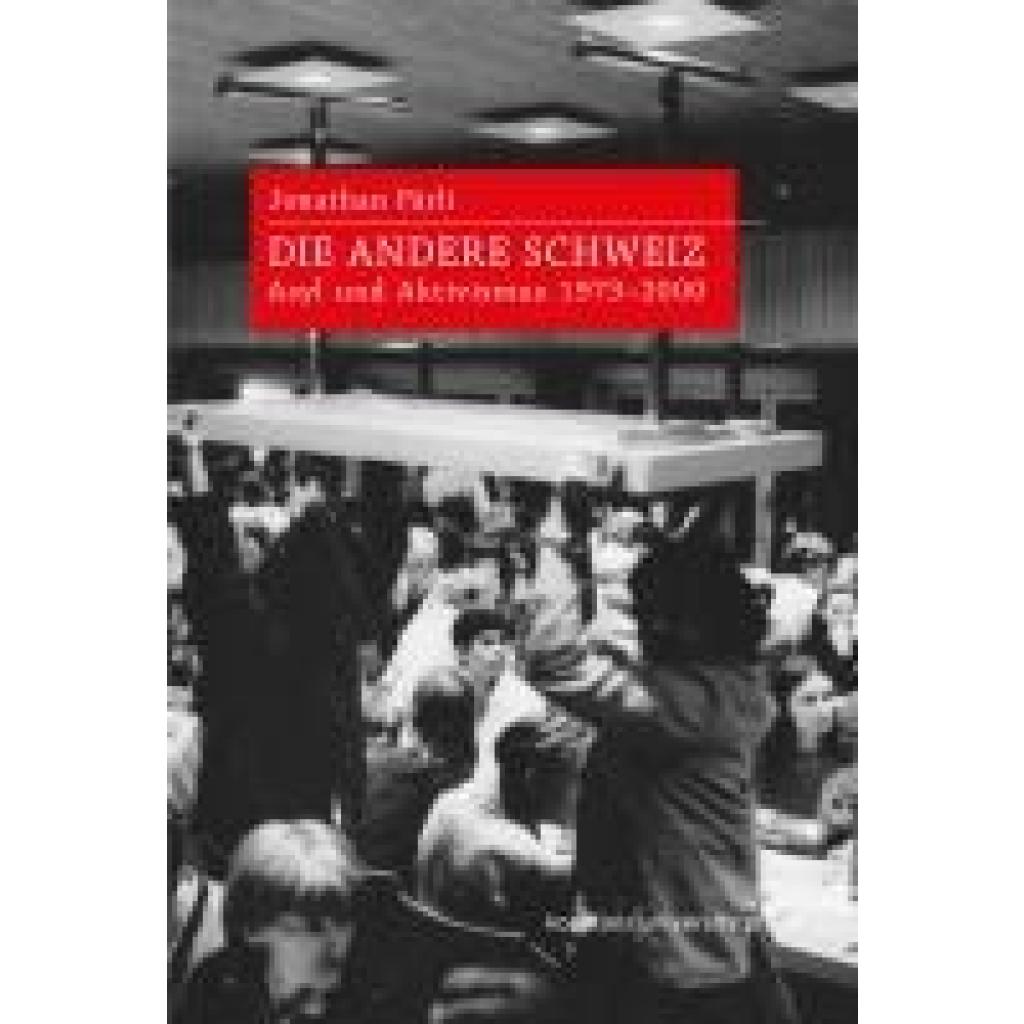Angesichts der »neuen Flüchtlinge« aus dem Globalen Süden und mit Ende des Nachkriegsbooms
zeichnete sich in den westlichen Gesellschaften seit den 1970er-Jahren eine restriktive Wende
in der Asyl- und Migrationsfrage ab. War es in dieser Konstellation denkbar eine
emanzipatorische Asylpolitik »von unten« zu praktizieren? Jonathan Pärli untersucht diese Frage
am Beispiel der »anderen Schweiz« einer innovativen und international vernetzten Solidaritäts-
und Protestbewegung. Abschottung und Abschiebungen sind keine Sachzwänge und liberale
Asylpolitik ist kein humanitärer Luxus. Von dieser Überzeugung getragen entstand in der Schweiz
seit 1973 eine soziale Bewegung. Impulse hierfür gingen von Geflüchteten aus Zaïre Chile der
Türkei oder Sri Lanka aus. In kollektiven Protesten und individuellen Wortergreifungen maßen
sie die Schweiz an ihrem Ruf als traditionellem Asylland. In Anlehnung an Hannah Arendt und
Jacques Rancière analysiert Pärli den Asylaktivismus in seiner demokratiepolitischen Bedeutung
und zeigt seine handfesten Erfolge auf. Ziviler Ungehorsam provozierte zwar Machtworte und
Strafverfolgung dies wiederum bot Gelegenheit für neuerlichen Widerspruch. Zugleich drohte das
Engagement stets in rein humanitäre Einzelfallarbeit abzudriften. Und auch der Schritt von der
grenzüberschreitenden Vernetzung hin zu Aktionen und Kampagnen für ein »anderes Europa«
gestaltete sich schwierig. Pärli rekonstruiert eindrucksvoll eine facettenreiche und
vielstimmige Geschichte des Asylaktivismus zwischen Politik Humanitarismus und enttäuschten
Hoffnungen.