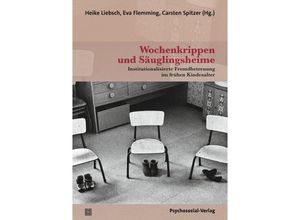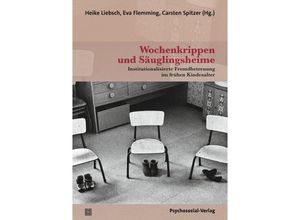In den 1950er und 1960er Jahren wurden in der DDR fast 40.000 Plätze zur wochenweisen
Fremdbetreuung von Kindern im Alter zwischen sechs Wochen und drei Jahren geschaffen.
Wochenweise bedeutete dass diese Kinder Tag und Nacht in der Einrichtung verblieben und ein
Kontakt zu ihren Eltern nur am Wochenende möglich war. Diese intensive Betreuungsform war eine
Voraussetzung dafür dass die Arbeitskraft der Frauen uneingeschränkt dem Aufbau der DDR zur
Verfügung stand. Jedoch passte es auch zum ideologischen Hintergrund bereits die Jüngsten
durch eine umfassende kollektive Erziehung zu einer »sozialistischen Persönlichkeit« zu formen
- mit teils lebenslangen Folgen für die Kinder. Die Geschichte der Wochenkrippen und die
Entwicklung der dort untergebrachten Kinder wird von den Autor*innen aus verschiedenen
Perspektiven nachgezeichnet und in den Kontext aktueller Forschungsergebnisse gesetzt. Dabei
richtet sich der Blick auch auf vergleichbare Einrichtungen jenseits der Grenzen der damaligen
DDR. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur für die persönliche und therapeutische
Aufarbeitung der ehemaligen Wochenkrippenkinder relevant sondern auch vor dem gegenwärtigen
Hintergrund der 24-Stunden-Kita-Angebote und der Heimeinrichtungen im Rahmen der Jugendhilfe.
Mit Beiträgen von Felix Berth Maya Böhm Eva Flemming Agathe Israel Christian Jakubaszek
Stefanie Knorr Patricia Lannen Karsten Laudien Sophie Linz Heike Liebsch Florian von
Rosenberg Antje Schunke Carsten Spitzer Jaroslav sturma und Susanne Vogel