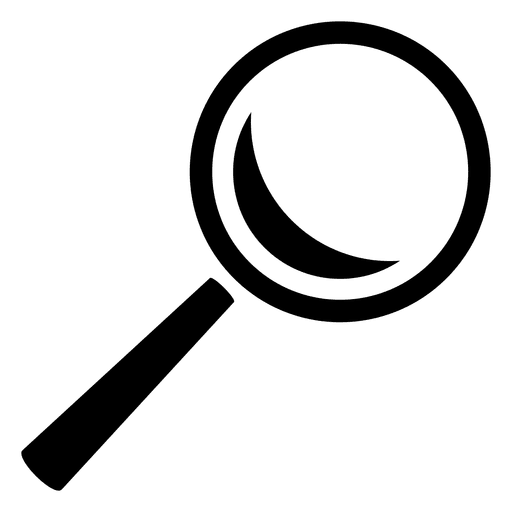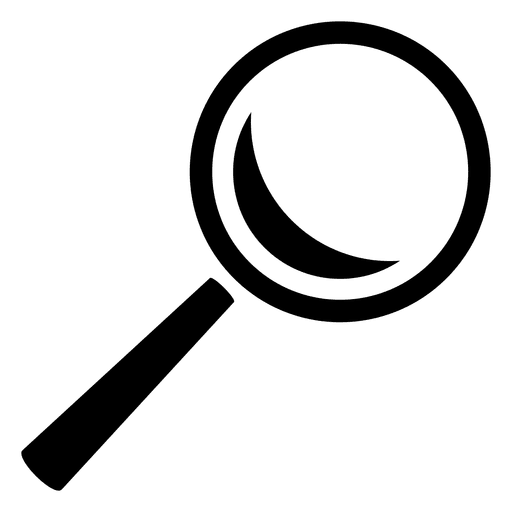Die grundlegende Instandsetzung des Nordflügels des Schlosses in Bleckede gelegen im Nordosten
Niedersachsens direkt an der Elbe wurde Ende 2021 abgeschlossen. Die dabei verwirklichte enge
interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglichte bauvorbereitend und baubegleitend weitreichende
Erkenntnisse die der interessierten Öffentlichkeit mit der vorliegenden Publikation zugänglich
und anschaulich gemacht werden sollen. Der Idee des conservation management folgend den Umgang
mit einem Baudenkmal systematisch in Beziehung zu seinen Denkmalwerten zu setzen wird der
Saalflügelbau aus dem Jahr 1600 als qualitätvolles materielles Zeugnis betrachtet in dem sich
Landes- und Mentalitätsgeschichte der Frühen Neuzeit manifestieren. Hier artikuliert sich der
Herrschaftsanspruch Herzog Ernsts II. von Braunschweig-Lüneburg in der Architektur ebenso wie
in der dekorativen und repräsentativen Ausstattung. Die Anlage findet um 1272 als Burg erstmals
schriftliche Erwähnung und war seit 1351 an die Stadt Lüneburg verpfändet. Erst 1561 gelang es
den Herzögen das Pfandgut zurückzuerwerben und 1600 entstand schließlich der bis heute
erhaltene Bau den dann der Amtmann Fritz von dem Berge bezog. Die folgenden Zeiten
insbesondere der Dreißigjährige Krieg hinterließen deutliche Spuren und bauliche
Veränderungen wurden immer wieder erforderlich. Anlässlich des 700-jährigen Stadtjubiläums von
Bleckede 1909 10 richtete man ein repräsentatives Entree mit Treppenhaus und
Kreistagssitzungssaal im Raum- und Formverständnis das das frühe 20. Jahrhundert von der
Renaissance entwickelt hatte ein. 1932 endete die Nutzung als Verwaltungssitz des Amtes bzw.
Kreises Bleckede. Heute sind die als Informationszentrum des Biosphärenreservats Elbtalaue
dienenden Baulichkeiten mit den Resten der Befestigungsanlagen und dem Schlossgarten als
architektonische und künstlerische Einheit anzusprechen. Der reich bebilderte Band hat das Ziel
die auf den Nordflügel bezogene handwerkliche bau- und kunstgeschichtliche Arbeit der
Spezialdisziplinen sowie die daraus gemeinsam gewonnenen Ergebnisse darzustellen und diese
kulturhistorisch als Teil des in den landesherrlichen Residenzen überkommenen Erbes
einzuordnen.