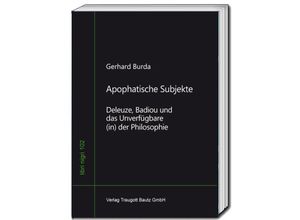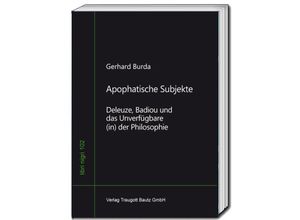Philosophien haben ebenso wie Mythen Religionen und Wissenschaften eine phantasmatische
Architektur. Diese Architekturen können untersucht werden um herauszufinden was sie
einschließen ausschließen oder wo sie jeweils an eine Grenze zum Unverfügbaren kommen. Dazu
ist es notwendig ein epistemologisches Format ins Spiel zu bringen welches das
Phantasmatische berücksichtigt und eine mediale Ontologie zu entwickeln in der alles als
selbst-differentes Medium oder als Verbindungs-und-Trennungsverhältnis aufgefasst wird. Auf
dieser medialen Immanenzebene mediatisieren Medien einander in ihrer Selbst-Differenz. Medien
sind apophatische Subjekte die im Innen- wie im Außenverhältnis etwas Unverfügbares berühren
das sich als Differenz-an-sich und Differenz-für-sich aufschlüsseln lässt. Gerade im
Unverfügbaren in dem was weder eingeschlossen noch ausgeschlossen werden kann lässt sich die
Basis von Freiheit vermuten. Sie besteht nicht zuletzt darin dass sich der Mensch zu seiner
existenziellen Selbst-Differenz verhalten kann was gerade in den unterschiedlich gewichteten
Architekturen der Philosophie zum Ausdruck kommt. Das Unverfügbare nicht aus den Augen zu
verlieren ist deshalb wichtig weil es nach dem offensichtlichen Scheitern des metaphysischen
Subjekts seiner Bemächtigungsstrategien und bevorzugten Referenten dennoch nicht reicht vom
Ende der Philosophie vom Tod des Subjekts oder von der Verabschiedung des Humanismus
auszugehen. Gegen diese Vereinfachung kann das Apophatische als Mandat genommen werden das
was weder ausgeschlossen noch eingeschlossen werden kann neu und ohne es auf seine alten Namen
zu reduzieren in Richtung einer Ethik des Unverfügbaren weiter zu entwickeln.