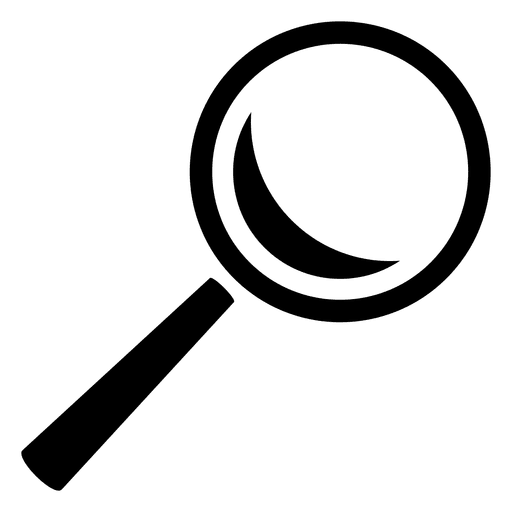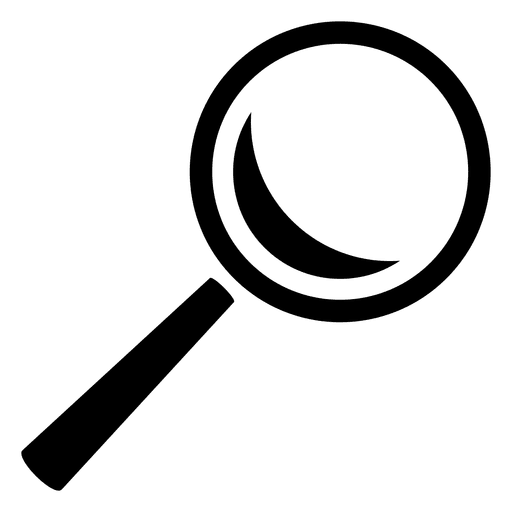Die sogenannte Digitalisierung beförderte Entwicklungen wie die sozialen Medien oder die
sharing-economy. Die letztgenannte medial getragene Wirtschaftsform prägen die Prinzipien der
Dezentralisation und der Selbstbestimmung. Mit der Peer-to-peer-(P2P)-Versicherung überführen
wiederum technologieaffine Insurtechs beide Leitideen ins Versicherungswesen: Nach einer
Mitteilung des Verbandes Bitkom vom 10.09.2018 biete die P2P-Versicherung die Möglichkeit
Risiken unter Bekannten abzusichern statt die klassische Risikoabdeckung über einen
Versicherungskonzern zu wählen. Ziel solcher Gestaltungen ist regelmäßig eine Absicherung von
Risiken die möglichst keine (Kosten-)Risiken birgt es geht um Ersparnisse gegenüber der
konventionellen Versicherung - sei es über a priori günstigere Prämien oder nachgelagerte
Rückzahlungen für den Fall der Schadenfreiheit. Der Verfasser ventiliert die solchen Modellen
zugrundeliegenden konsumentenpsychologischen Anreizwirkungen exemplarisch geht er unter Rekurs
auf die historische Assekuranz der Attraktivität der Assoziation der Versicherung unter
Freunden auf den Grund. Darüber hinaus typisiert er grundlegende Schattierungen eines von ihm
dargelegten rechtlichen Begriffs der P2P-Versicherung. Zugleich wird die Abhandlung konzise
erhellen dass die existenten P2P-Versicherungs-Modelle de facto nicht auf den Risikotransfer
auf Versicherer verzichten (können) prägend sind regelmäßig lediglich Elemente einer
unterschiedlich nuancierten Einbindung von Privatpersonen in die Risikotragung. Begreiflich
macht dies die kautelarjuristische Auseinandersetzung des Verfassers mit mehreren Modellen
eines deutschen P2P-Anbieters. Darauf aufbauend analysiert er eine Vielzahl rechtlicher
Implikationen für die Strukturierung aber auch das Marketing von P2P-Versicherungs-Lösungen.