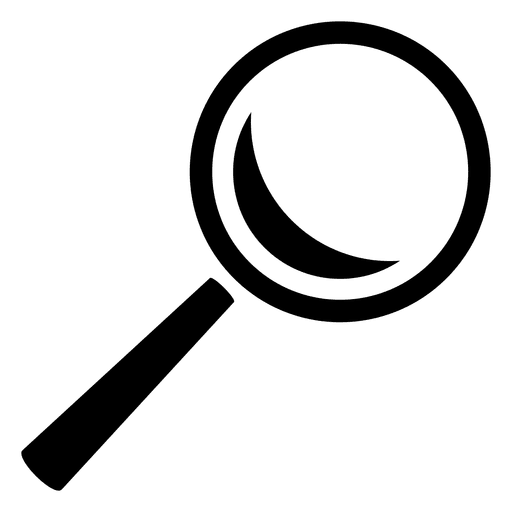Die westliche Moderne kennzeichnet bis heute ein langer widersprüchlicher Prozess um die
Statuierung der Menschenrechte. Es waren die schrecklichen Erfahrungen mit den Totalitarismen
des letzten Jahrhunderts die schließlich den Diskurs darüber in eine weitest gefasste
abstrakte »Erklärung« goss. Abgeleitet allein aus seinem elementaren nackten Menschsein sollte
die Würde des Einzelnen durch Rechte mit unbedingtem universellem Geltungsanspruch garantiert
werden. Diese verabsolutierende Sakralisierung der Menschenrechte forcierte zum einen die
zunehmende Verdrängung des Politischen durch eine sich universell verstehende Moral in den
westlichen Gesellschaften was - wie sich heute gut sehen lässt - zu einem im tiefer gehenden
Konflikt zwischen dem Einzelnen und dem Staat der Gemeinschaft als ethischem kulturellem
Gebilde führte. Zum anderen verschärfte sie nach außen getragen als eine neue Form
imperialistischen Anspruchs den ideologischen Konflikt zwischen den Kulturen. Wobei der Westen
der auf der gleichzeitigen Entwicklung von Wissenschaft und Kapitalismus gründet sich stets
auf sein ausgeprägtes liberales Demokratieverständnis beruft und vor allem globale
Ökonomisierung meint. Letztlich zielen beide Ausrichtungen mit der Ideologisierung der
Menschenrechte auf ein supranationales Konstrukt als eine Art »Welteinheitsstaat« ab. Der
Philosoph Rudolf Brandner hat in einem ersten großen Abschnitt seines souverän vorgetragenen
Essays die Widersprüche des Menschenrechtsdiskurses in all ihren geschichtlichen und
kulturellen Verästelungen großräumig dargelegt. In einem zweiten Teil geht er stets anschaulich
auf die ethischen rechtlichen und politischen Implikationen ein. Der ethische Gehalt der
Menschenrechte wird dabei nie in Frage gestellt - sehr wohl aber wird ihre ideologische
Rechtfertigung die tiefe Einsichten in die geschichtliche Verfasstheit moderner Gesellschaften
und ihres Freiheitsverständnisses gewährt scharf in den Blick genommen.