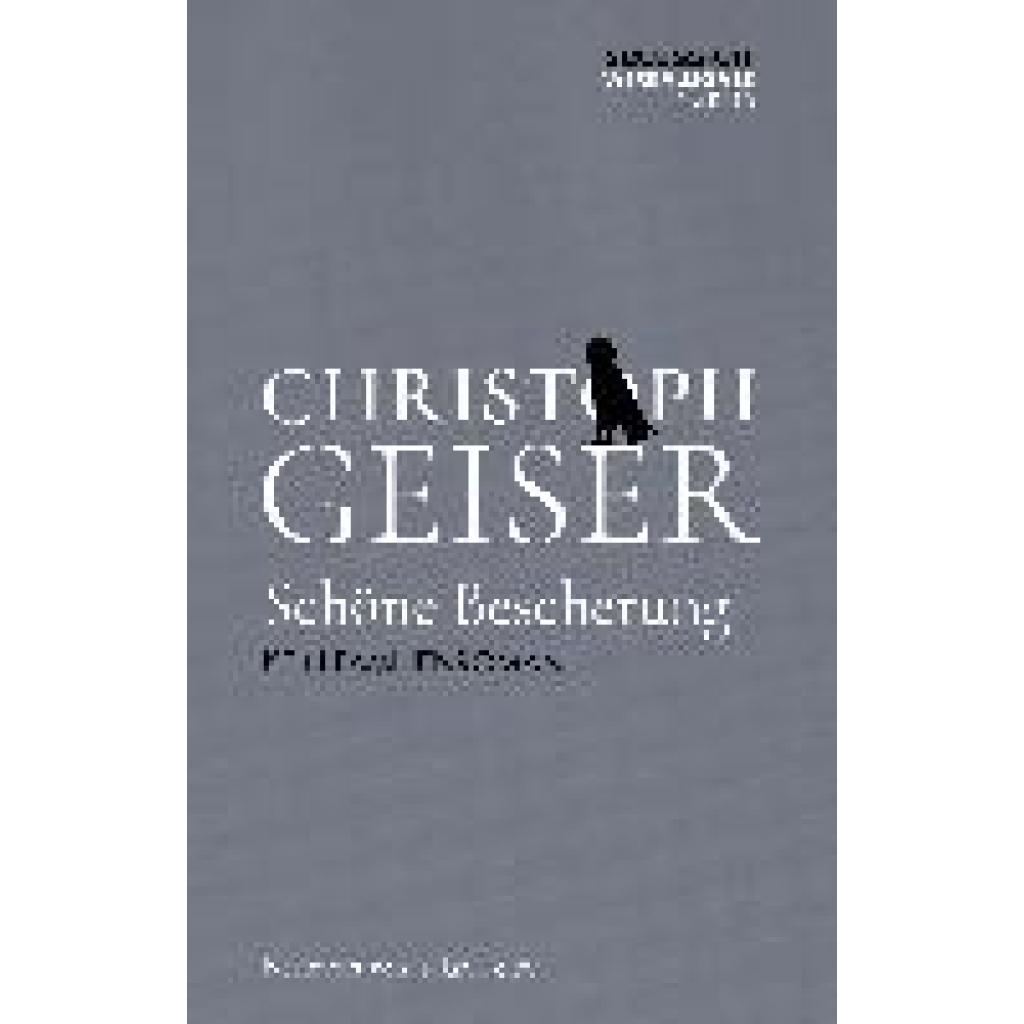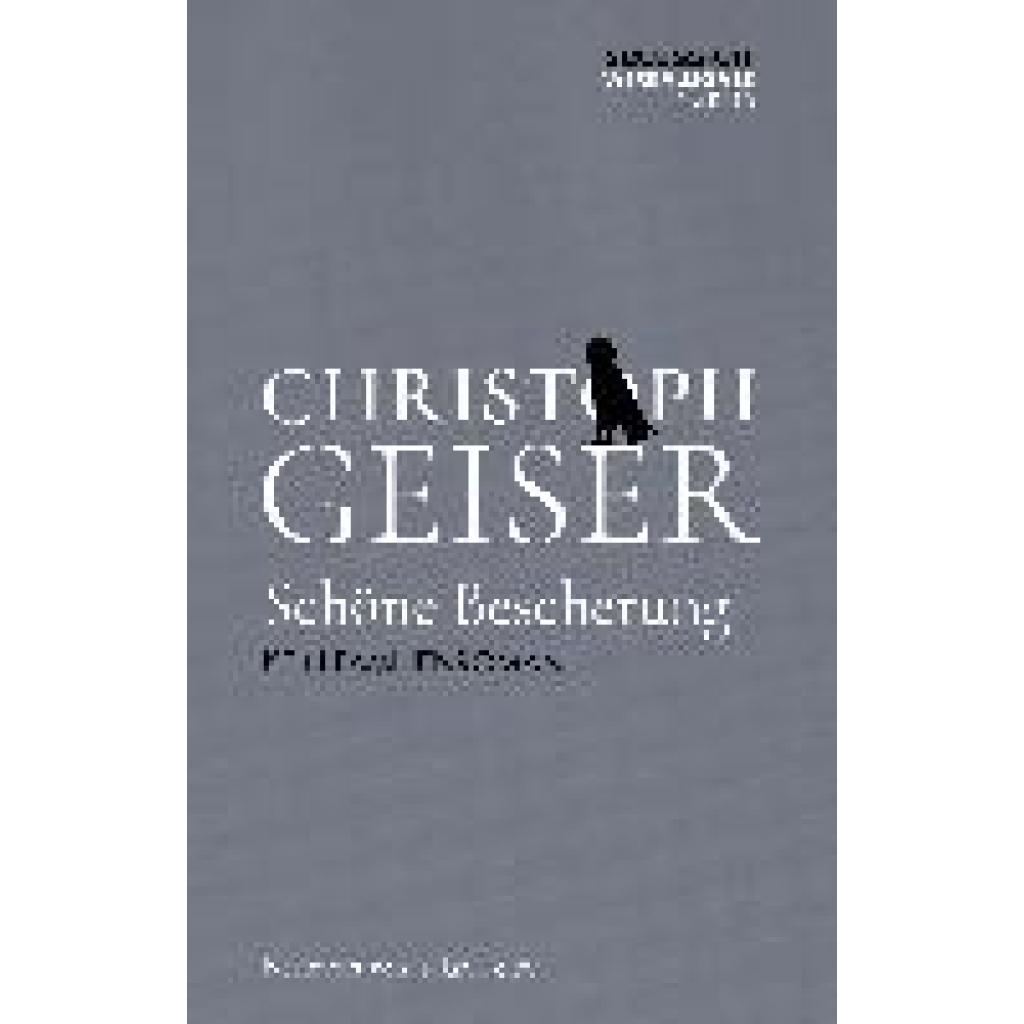Mitten im Boom der Erinnerungsliteratur und Familienromane erschien 2013 ein Buch mit einem
aufsehenerregenden Untertitel: »Kein Familienroman« deklariert Christoph Geiser auf dem Cover
von Schöne Bescherung. Gesetzt wird diese Lektüreanweisung ausgerechnet von jenem Autor der
mit seinen frühen Werken Grünsee (1978) und Brachland (1980) die wichtigsten Familienromane der
jüngeren Schweizer Literatur schuf. In der Tat findet Geiser in Schöne Bescherung zu einem
neuartigen erzählerischen Umgang mit Erinnerung mit der eigenen Herkunftsidentität und vor
allem der eigenen Endlichkeit. Der Erzählfluss in der Wir-Form gehalten und in einem
intellektuellen und darum nicht minder witzigen Parlando dahinplätschernd beginnt mit dem
Krebstod der Mutter durch den die alternde Erzählinstanz »von Beruf Erbe« wird. Geplagt von
eigenen Gebresten und selbstzweiflerischem Hadern mit der Schriftstellertätigkeit ergeht sich
dieser bald lustvoll flanierende bald vom als »Monsieur Lamort« personifizierten Tod gehetzte
Erzähler in Reflexionen über Ästhetik Sex und Tod die nie selbstverliebt oder
selbstquälerisch anmuten sondern stets beeindruckend-blitzlichthafte Einblicke eröffnen.