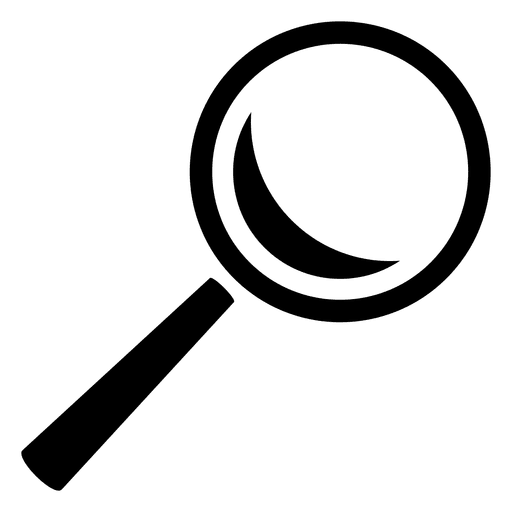Es fällt zunehmend schwer sich die unmenschlichen Bedingungen auszumalen unter denen die
Soldaten im Ersten Weltkrieg an den verschiedenen Frontabschnitten kämpften da die
historischen Quellen wie etwa Zeitungsartikel Frontberichte u.ä. in vielfacher Hinsicht ein
verzerrtes Bild von der Situation an der Front liefern. Denn zum einen wurden die
Beschreibungen in der Regel von Personen verfasst welche die Schrecken der Grabenkämpfe nur
unzureichend kannten. Zum anderen gab es im Krieg eine strikte Zensur mit dem Ziel die
Kampfmoral der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Die Widergabe der Stimmung in der Truppe wurde
daher in geradezu systematischer Weise geschönt. Wie jedoch fühlten sich die einfachen Soldaten
tatsächlich? Wie entwickelte sich die Stimmung im Verlauf der Kriegsjahre? Was dachte man an
der Front über die Entscheidungen der Regierung und des Generalstabs? Hielt sich die
anfängliche Kriegseuphorie oder stellte sich mit andauerndem Schrecken zunehmende Ernüchterung
ein? Diese und viele weitere Fragen sind nicht nur für Historikerinnen und Historiker von
brennendem Interesse. Vielmehr könnte die Beantwortung dieser Fragen den Ersten Weltkrieg in
einem neuen Licht erscheinen lassen. Ann-Katrin Fett wertet die bisher zu wenig beachtete
Quellengattung der Feldpostbriefe aus. Diese Briefe - ausgetauscht zwischen Frontsoldaten und
ihren Lieben in der Heimat - gewähren wie kein zweites Medium Einblicke in die Gedankenwelt
einer Menschengruppe die ansonsten in den historischen Quellen kaum einen Niederschlag
gefunden hat. Sie geben intime Gefühle und Einschätzungen wieder und lassen gesellschaftliche
Stimmungen und überpersönliche Wahrnehmungsmuster erkennen. Die Autorin zeigt wie die brutalen
Materialschlachten und endlosen Kraterlandschaften den Blick der Zeitgenossen auf den Tod und
die eigene Sterblichkeit veränderten und wie sich dies schriftsprachlich niederschlug. Sie
analysiert welche Dissonanzen sich aus den unterschiedlichen Erfahrungswelten von Front und
Heimat ergaben und welche Rolle die Feldpost bei der Überbrückung derselben spielte. Dabei
kann sie zahlreiche sprachliche Bewältigungsmechanismen und beschwörende Sprachhandlungen
nachweisen - offenbar eine Distanzierung zur Kriegsrealität. Häufig äußert sich dies durch
Verharmlosungen sowie eine starke Konzentration auf alltägliche unpolitische Themen. Eine
wichtige Erkenntnis ist dass sich die Sprache in den Feldpostbriefen zwischen 1914 und 1918
verändert hat. Auf diese Weise gelingt es der Autorin auch allgemeine
mentalitätsgeschichtliche Entwicklungen sichtbar zu machen.