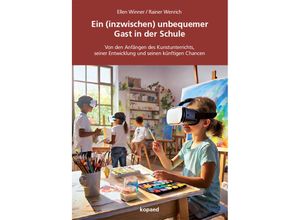Die Entwicklung der Kunstpädagogik in den USA und dem deutschsprachigen Raum (hier vor allem
Deutschland und Österreich) seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts lässt sich am
deutlichsten dadurch beschreiben indem man als Ausgangspunkt einen zweckorientierten und
streng organisierten Zeichenunterricht betrachtet und sich von diesem Punkt aus vorbei an den
Stationen unterschiedlicher Fachbezeichnungen und fachdidaktischer Konzeptionen im Wandel der
Zeit hin zu einer Vermittlung und Übersetzung von vielfältigen Gestaltungsformen der
Ausgestaltung kunstpädagogischer Handlungsräume (analog digital partizipativ und inklusiv
interaktiv und performativ) und der Beschäftigung mit visuellen Kulturen inmitten einer
mehrdimensionalen Transformation in Gesellschaft und Bildung bewegt. Ellen Winners Geschichte
des Kunstunterrichts und Rainer Wenrichs einführende Anmerkungen zeigen auf wie sich der
Kunstunterricht bis in das 21. Jahrhundert entwickelt hat und welche Stellung er in unserer
Zeit einnehmen kann. Die kunstpädagogischen Konzeptionen umfassen derzeit eine breite Palette
von Aktionsmöglichkeiten die eine sich verändernde Landschaft des künstlerischen Ausdrucks und
die für den Erfolg in der heutigen und künftigen Welt erforderlichen Fähigkeiten widerspiegeln.
Hierbei spielen vor allem digital-technologische Innovationen wie AR VR und (generative) KI
und das Bewusstsein für gesellschaftlich relevante Themenstellungen auf Seiten des
Kunstschaffens und der Kunstvermittlung eine Rolle.Zwischen den genannten historischen Eckdaten
lassen sich mithilfe des historisch-vergleichenden Blicks auf die Entwicklungen des
Kunstunterrichts in den USA und Deutschland parallele Entwicklungen Problemfelder und auch die
Leistungen von fachlichen Protagonistinnen und Protagonisten auf beiden Seiten des Atlantiks
sichtbar machen. Sowohl in den USA als auch in Deutschland wird der Verlauf einer lebendigen
und vielschichtigen Fachgeschichte erkennbar die bestimmt ist durch die Randmarken teils
kontroverser Diskussionen der Fachvertreterinnen und Fachvertreter unterschiedliche Theorien
und Positionen einer methodisch vielschichtigen Forschung die zwischen der Untersuchung und
dem Herausarbeiten von fachlichen Spezifika künstlerischen und kunstpädagogischen Denk- und
Handlungsmustern bis hin zu einem Beharren auf Transferwirkungen des Kunstunterrichts auf
andere Fachbereiche und der politischen Vereinnahmung gleichlautender wissenschaftlicher
Erkenntnisse pendelt. Schließlich sei auch auf die anhaltenden und kräfteraubenden
Anstrengungen zur Rechtfertigung des Kunstunterrichts und seinen vielfältigen Zielen verwiesen
die sich in den USA ebenso wie im deutschsprachigen Raum beobachten lassen.In ihrem Band Ein
unbequemer Gast im Schulhaus. Von der Kolonialzeit in eine vielversprechende Zukunft erzählt
Ellen Winner wie die Kunstpädagogik in den Vereinigten Staaten angesichts der anhaltenden
Marginalisierung der Künste im amerikanischen Bildungssystem konzeptualisiert gerechtfertigt
und gelehrt wurde. Der Kunstunterricht wurde häufig mit Ergebnissen begründet die nichts mit
Kunst zu tun hatten. Im 19. Jahrhundert kopierten die Kinder pflichtbewusst Zeile für Zeile die
Bilder die ihnen von ihren Lehrkräften vorgegeben wurden und mit dieser Ausbildung sollten den
Kindern die zeichnerischen Fähigkeiten für eine künftige Tätigkeit in der Industrie vermittelt
werden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der von John Dewey
inspirierten reformpädagogischen Klassenzimmer wurden die Kinder ermutigt sich frei
auszudrücken. Nun galt es das künstlerische Schaffen im Kind zu fördern und das emotionale
Wohlbefinden zu unterstützen. Später mit der Bewegung der Rechenschaftspflicht im
Bildungswesen wurde die Kunstpädagogik mit ihrem vermeintlichen Potential gerechtfertigt
standardisierte Testergebnisse zu verbessern. Seit dem 19. Jahrhundert schwankt das Pendel in
den Vereinigten Staaten immer wieder zwischen reformpäd