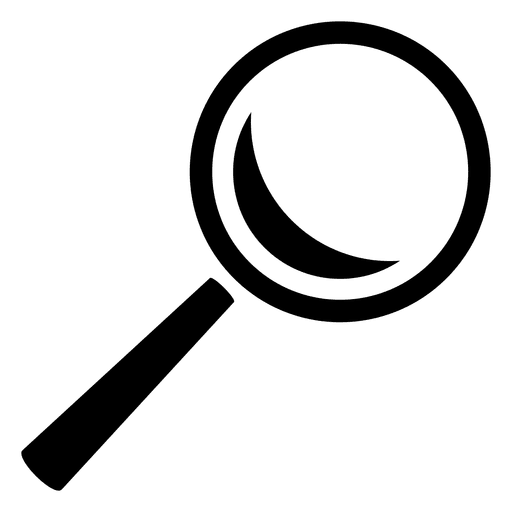Der in § 2065 BGB niedergelegte Grundsatz der Selbstentscheidung bei Errichtung letztwilliger
Verfügungen wirft viele Fragen auf. Rechtsprechung und Literatur plädieren im Widerspruch zum
Wortlaut der Norm oftmals für eine Zulässigkeit des Abstellens auf den Willen Dritter wobei
sie zugleich eng verwandte Fallgestaltungen hinsichtlich ihrer Gültigkeit unterschiedlich
beurteilen. Da zur Abgrenzung zuweilen ihrerseits interpretationsbedürftige Begriffe
herangezogen werden ist die Beurteilung der Rechtswirksamkeit erbrechtlicher Anordnungen oft
schwierig. Der maßgebliche Grund für diese unklare Situation scheint nun im Gesetz selbst
angelegt zu sein. Der Grundsatz der Selbstentscheidung wird so lautet eine oft verwendete
Formulierung im Erbrecht nicht streng durchgehalten und in einer Vielzahl von
Ausnahmevorschriften durchbrochen. Wohl deshalb will die überwiegende Auffassung auch den
Anwendungsbereich des § 2065 BGB selbst beschränken. Die Überprüfung der Zulässigkeit dieser
Grundkonzeption der überwiegenden Auffassung stellt das Thema der vorliegenden Arbeit dar. Die
hierfür zentrale Grundfrage lautet ob das Gesetz tatsächlich den einmal aufgenommenen
Standpunkt nicht durchhält und an anderer Stelle relativiert weshalb konsequenterweise der
Ausgangspunkt selbst zu hinterfragen ist oder ob nicht statt dessen gerade das Zusammenspiel
von Grundsatz und Ausnahmevorschriften ein sinnvolles Ganzes ergibt. Die Beantwortung erfolgt
in zwei gedanklichen Schritten. Zunächst wird eine Arbeitshypothese formuliert wonach die
Gesamtheit aller den Grundsatz der Selbstentscheidung betreffenden Normen offensichtlich die
Vorteile dieses Prinzips unter gleichzeitiger Vermeidung seiner Nachteile verwirklichen will.
Daran anschließend soll anhand von konkreten Fallkonstellationen die Tragfähigkeit dieser
Überlegung belegt werden. Die Untersuchung will dabei auch einen Beitrag leisten um die
angeblich nahezu unüberschaubare Vielzahl unterschiedlicher Fallgruppen auf ei